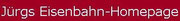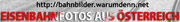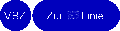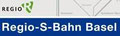Volle Züge, entnervte Fahrgäste und keine Aussicht auf ein Ende des Chaos bei der S-Bahn. Auch die S-Bahn-Mitarbeiter sind sauer.
Ein Triebfahrzeugführer berichtet exklusiv auf Morgenpost Online, wie er die aktuelle Krise erlebte. Dabei spricht er über seine Hilflosigkeit und seine Wut auf den Konzern.
Das Chaos hat für mich nachts um drei begonnen. Vorige Woche Dienstag in der Nachtschicht. Ich hatte gerade Pause, da hieß es plötzlich: „Kollege, dein Zug wird nicht mehr
wieder eingesetzt.“ Ich wusste überhaupt nicht, was los war. So wie mir ging es vielen Kollegen. Ein Zug nach dem anderen verschwand in der Werkstatt, wir wunderten uns nur. Und die Kollegen in der
Leitzentrale versuchten noch, das Beste daraus zu machen, bis sie merkten, dieses Chaos war nicht mehr beherrschbar.
Was los war, hat sich dann erst im Laufe des Montags herausgestellt. Inzwischen läuft es zwar etwas besser, aber es kommt immer noch vor, dass den Fahrern die Züge einfach im laufenden Betrieb
herausgenommen werden. Und die Fahrgäste stehen rum und sind genervt. Ein Zug fällt aus, sie warten 20 Minuten, der nächste Zug hat Verspätung, und wenn er kommt, ist er komplett überfüllt. Ich hatte
in den letzten Tagen Schicht zwischen Königs Wusterhausen und Südkreuz – wir fahren ja nicht mehr bis Westend, sondern nur noch nach Südkreuz –, und man sieht immer schon von Weitem, dass die
Bahnsteige schwarz sind vor Menschen. Sicher, wir sind darauf eingestellt, in Ausnahmesituationen wie an Silvester oder der WM 2006 erleben wir einen solchen Ansturm regelmäßig.
Ich bin jetzt seit 23 Jahren Lokführer bei der S-Bahn, aber solche Zustände habe ich nur nach dem 9.November 1989 erlebt. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Wir transportierten
damals zwar ähnliche Menschenmassen, aber eine ganz andere Stimmung. Das war Euphorie pur, die Leute haben das Gedrängel gern in Kauf genommen, nur um an die Friedrichstraße und in den Westen zu
kommen.
Ärger mit den Fahrgästen
Jetzt erinnert mich die Arbeit wieder an diese Zeit. Ab Grünau und Adlershof sehe ich morgens Bahnsteige, die sind schwarz vor Menschen. Man ist schon immer in Sorge, dass mal
einer unter dem Zug verschwindet, egal, wie langsam man einfährt. Dann werden die Züge so rappelvoll, hinter der Glasscheibe im Wagen sehe ich die Fahrgäste wie die Ölsardinen stehen. Und das wird
von Bahnhof zu Bahnhof schlimmer, im Berufsverkehr steigen ja immer nur Menschen ein – und niemand wieder aus, bis wir in der Innenstadt sind. Sich hinzusetzen und gemütlich Zeitung zu lesen wie
sonst, das ist momentan nicht drin.
Natürlich gibt es auch richtig Ärger. Als ich neulich am Melderaum auf dem Bahnsteig stand, beschimpfte mich jemand, ich sei ja wohl das Allerletzte. Aber was kann ich denn dafür? Sicher sind
solche Reaktionen menschlich. Wir bemühen uns, Verständnis zu zeigen. Andererseits sind wir Lokführer nie im Umgang mit Fahrgästen geschult worden. Manchen Kollegen fällt schon das Formulieren der
Mikrofondurchsagen schwer.
Glücklicherweise ist der Pendler als solcher offenbar ein Geduldsmensch. Wer sich entscheidet, mit der S-Bahn zu fahren, sagt sich offenbar: „Ich steh auf der Stadtautobahn
genauso im Stau, da kann ich mich auch in den Zug quetschen.“ Ungeduldig sind dagegen vor allem die Leute, die am Vormittag unterwegs sind. Neulich hat eine ältere Dame einen jungen Kollegen
angeblafft: „Das ist hier schlimmer als im Krieg!“ Was soll man da sagen? Der Kollege hat zum Glück schlagfertig gekontert: „Oh, im Krieg? Ach, da hatte ich Urlaub!“ So kann man Situationen
entschärfen. Aber das acht bis zehn Stunden am Tag auszuhalten ist anstrengend. Und die Bahn hat offenbar nicht das Personal, um die Situation zu entschärfen.
Ich habe beobachtet, dass die meisten Fahrgäste eine schlechte Beförderungsleistung für eine Weile in Kauf nehmen. Aber sie wollen darüber informiert werden. Das können wir
nicht bieten. Es gibt oft nicht mal mehr Handzettel mit Informationen. Und wir, die Fahrer, sind an vielen Bahnhöfen die einzigen Ansprechpartner. Wenn ich meinen Zug selbst abfertige, muss ich dafür
aussteigen und bin an der Dienstkleidung gut erkennbar. Ich stehe meist nicht am Kopf des Bahnhofes wie sonst, sondern fast in der Mitte, weil wir ja verkürzte Züge fahren, mit sechs statt acht
Wagen.
Ich muss den Bahnsteig beobachten, bis alle eingestiegen sind. Manche Bahnsteige sind gekrümmt, da wird es schwierig, zu sehen, ob irgendwo noch eine Jacke klemmt oder ob man
diese Situation hat „Oma drin, Hund draußen“, wie wir es immer nennen. Der Horror aller Fahrer bei der „Selbstabfertigung“ ist, dass man jemanden mitschleift. Zum Glück ist bislang nichts passiert.
Wir drücken uns auch selbst die Daumen. Der betroffene Kollege landet hinterher beim Psychiater. Das wünscht man keinem.
Pro Schicht fährt man bis zu 200 Stationen an, bei der Ringbahn sind das sieben Runden. Das stresst, wenn jedes Mal volle Konzentration gefordert ist. Nach so einer Schicht
weiß man, was man getan hat. Und man muss leider auch sagen, auf die Ansage „Zurückbleiben!“ hören viele Leute nicht. Der Fahrgast an sich ist eben ein undiszipliniertes Wesen. Die Leute drängeln
sich noch beim Schließen der Türen hinein. Man kann nicht gleichzeitig nach vorn auf die Strecke gucken und nach hinten auf den Bahnhof. Eigentlich sollte es dafür längst eine Kameraüberwachung
geben. Die Bildschirme dafür fahren wir seit zwei Jahren im Führerstand spazieren – sie sind tot, aus dem Projekt wurde nichts. Eins von vielen Dingen, die schlecht gelaufen sind in den letzten
Jahren.
Reizklima in der Leitzentrale
In den Pausenräumen gibt es momentan kein anderes Thema mehr. Schlechte Stimmung, egal wo. Auch in der Betriebsleitzentrale herrscht deshalb seitdem absolutes Reizklima. Dort
sitzen die Kollegen, die die Züge und die Fahrer koordinieren müssen. Weil so wenig Züge fahren, kommen die Fahrer zwar zur Arbeit, melden sich an ihren Meldestellen, aber dann sitzen sie in
Bereitschaft rum. Denn nicht nur der Fahrplan ist außer Kraft, sondern auch unser Dienstplan. Wir werden nur noch auf Zuruf eingesetzt, das führt zu viel Ärger, weil man nie weiß, wann die Schichten
genau anfangen.
Unsere Schichten sind selbst im Normalfall nicht sehr familienfreundlich. Ein Frühdienst kann morgens um 3.15 Uhr beginnen oder erst um sieben Uhr, ebenso kann das Dienstende
morgens um neun sein oder auch nachmittags um 16 Uhr. Das alles wissen wir normalerweise fünf Tage im Voraus – jetzt nicht mehr. Darunter leiden die Familien der Fahrer natürlich auch.
Wo wir eingesetzt werden, ist ganz unterschiedlich. Die meisten kommen selbst mit der S-Bahn. In der jetzigen Situation müssen wir natürlich noch früher los als sonst, für
einen Eisenbahner gibt es nichts Schlimmeres, als unpünktlich zu sein. Man hat ja seine Ehre. Kollegen aus dem Umland fahren für die frühen Frühdienste oft schon nachts los – zum Beispiel mit dem
letzten Zug gegen 0.30 Uhr, dann warten bis Schichtbeginn 3.30 Uhr oder 4.30 Uhr. Früher wurden die Schichten so gelegt, dass das nicht nötig wurde. Heute richtet sich alles nach der höchstmöglichen
Effektivität für den Konzern. Dass wir die Fünf-Tage-Regelung noch haben, liegt nur daran, dass wir vor zwei Jahren darum gekämpft haben, als sie abgeschafft werden sollte.
Es gab ähnliche Fälle
Dass es zu einem solchen Chaos kommen würde, haben wir nicht geahnt. Sicher, 2003 gab es schon einmal einen Radschaden an einer S-Bahn. Aber in der Geschichte der Eisenbahn hat
es immer wieder solche technischen Probleme gegeben. Die Sache ist, dass es dem Eisenbahnbundesamt offenbar verheimlicht wurde.
Das Eisenbahnbundesamt hat eine Berechtigung wie die Kriminalpolizei, im Haus herumzuwühlen, das finde ich auch richtig so. Die Kriminalpolizei belügt man nicht ohne Strafe –
und auch diesem Fall fordern wir, dass die Betreffenden zur Verantwortung gezogen werden. Und zwar alle.
Ich muss mich als Mitarbeiter auf meine Vorgesetzten verlassen können. Es geht ja bei uns nicht nur um einen Imageschaden, sondern um die Sicherheit der Fahrgäste. Und um meine
eigene Sicherheit! Ich muss mich darauf verlassen können, dass die Züge technisch einwandfrei sind. Das ist wie im Luftverkehr. Eine S-Bahn kann bis zu 1200 Menschen transportieren: so viel wie vier
oder fünf Flugzeuge. Das Vertrauen in die Unternehmensführung ist erschüttert. Wir zweifeln, dass sie das Richtige tut.
Aber dieser Mist hat ja eine viel längere Geschichte als diese Sache von 2003. Wir Lokführer haben gesehen, was seit der Bahn-Privatisierung passiert ist. Das Chaos jetzt ist
für mich die direkte Folge. Es sollte alles billiger werden – jetzt ist es so billig geworden, dass es gegen den Baum gefahren ist. Die Verkehrssenatorin ereifert sich. Aber sie ist doch
mitverantwortlich! Sie will die Verkehrsleistung so billig wie möglich haben. Sie hat aber die Mittelkürzungen seit 2000 mitgetragen und die Abschaffung der Bahnsteigaufsichten. Jetzt sind alle
sauer, dass sie weg sind.
Wir hoffen auf eine Information bei der Mitarbeiterversammlung diese Woche. Da soll der Aufsichtsrat sprechen, allerdings sind das ja dieselben Leute, die auch die alte
Geschäftsführung berufen haben. Und ich glaube nicht, dass es nur ein paar in der Geschäftsführung waren, die das Chaos verantwortet haben. Es gab genug Warnungen. Das mit den Achsen und Rädern ist
nur das i-Tüpfelchen. Das musste mal passieren – und es ist ja auch nicht das erste Mal. Wir wissen heute, dass die S-Bahn nicht mehr in der Lage ist, Störfälle zu beherrschen. Im letzten Winter zum
Beispiel gab es für einige Tage einen ähnlichen Engpass – angeblich konnten Züge wegen eingefrorener Fahrsperren nicht fahren. So ein Quatsch! Das war einfach ein Wartungsmangel. Wir können froh
sein, dass jetzt Sommer ist, sonst wäre die Geduld der Fahrgäste schon längst zu Ende. Und was während der Leichathletik-WM demnächst werden soll, tja – da habe ich nur drei Fragezeichen im
Kopf.
Mehr als ein Arbeitgeber
Wir machen uns Sorgen. Was, wenn der Senat nun statt der S-Bahn die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) beauftragt? Für deren Löhne wollen wir nicht arbeiten. Das ist
Sozialdumping. Wir haben einen qualifizierten Beruf, fahren alle Baureihen, alle Strecken. Aber wir haben keine entspannten Phasen wie ein ICE-Lokführer, der auch mal zwei Stunden nur fährt. In der
U-Bahn gibt es die automatische Abfertigung – wir machen alles selbst, im Minutentakt. Ein S-Bahn-Fahrer bekommt nach der Ausbildung 2300 Euro, nach 25 Jahren sind es rund 2700 Euro. Das ist nicht zu
viel.
Und die S-Bahn ist für uns mehr als nur ein Arbeitgeber. Wir sind eine Familie, S-Bahner verbringen viel Freizeit zusammen, schon allein wegen der Schichtarbeit, aber auch
darüber hinaus. Sei es beim Sport, mit dem Motorrad, sie machen Modellbau. Die S-Bahn ist ein Mythos. Und bei allem Frust möchte ich auch betonen: Ich liebe meinen Beruf. Ich wollte nie etwas anderes
als Lokführer sein. Das Schönste daran, wenn Sie mich fragen, ist, wenn ich Zeit habe, vom Führerstand meine Stadt zu beobachten. Wie sie sich verändert hat in all den Jahren. Frühmorgens um vier,
wenn die Sonne aufgeht, wie dann langsam alles erwacht. Oder auch im Winter, in der Dämmerung mit all den Lichtern: Berlin ist einfach etwas ganz Besonderes.
 info 24
ÖV - Bahn - Bus - Tram - Schiff
info 24
ÖV - Bahn - Bus - Tram - Schiff