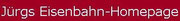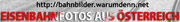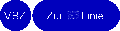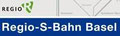Selbstmörder und S-Bahn-Surfer erleben viele Lokführer in ihrer Berufslaufbahn. Doch manche können einen solchen "Unfall" nicht verarbeiten. Lehrlokführer Rolf-Dieter Windeln berichtet aus seiner Laufbahn.

Rolf-Dieter Windeln mit seiner alten Lokführer-Mütze an einer Bahnhaltestelle. Der Lehrlokführer hat bereits viele Suizidfälle und S-Bahn-Surfer erlebt.
Foto: Detlef Ilgner
Dieses Geräusch wird er nie vergessen, sagt Rolf-Dieter Windeln mit einer erstaunlichen Gelassenheit. Die hat er sich in knapp vier Jahrzehnten als Lokführer erarbeitet. Aber damals, als er gerade in der Ausbildung war und auf der Strecke Kempen-Krefeld seinen ersten "Unfall" hatte – so werden Selbstmörder genannt – war das nicht so einfach. "Ein unwahrscheinliches Geräusch, wenn ein Mensch von einer Lokomotive verarbeitet wird", sagt Windeln. Oder wenn ein Bahn-Surfer zu nah an die Stromleitung kommt und 15 000 Volt durch seinen Körper fließen, so wie jüngst bei einem jungen Viersener im Mönchengladbacher Hauptbahnhof geschehen.
Der 68-jährige Windeln ist Lehrlokführer, seine Lieblings-Lok ist die 103er; er hat bei der Bahn jahrelang Lokführer ausgebildet und sie danach im Berufsleben begleitet. Für rund 700 Kollegen in NRW war er zuständig. Und in dieser Zeit hat er viele Suizid- und Surfer-Fälle miterlebt. "Es gibt heute wesentlich mehr "Unfälle" als noch vor 30 Jahren", sagt er. Kollegen sind gekommen und gegangen, Windeln blieb und versuchte, es den Lokführern so erträglich wie möglich zu machen, wenn es wieder mal einen "Unfall" gegeben hatte.
"Wenn jemand auf den Schienen steht, haben wir überhaupt keine Chance", sagt Windeln. Der Bremsweg einer Lokomotive ist 700 bis 1000 Meter lang, und Ausweichen geht nicht. Sein Lehrer gab ihm deshalb den Tipp, den er heute weitergibt: "Bremsen und weggucken." Und auf Hilfe warten. Damit werden einige seiner Kollegen nicht fertig. Oft leiden sie jahrelang unter einem solchen "Unfall", allein, wenn sie die Stelle erneut passieren, krabbelt die Kälte den Rücken hoch. "Bei vielen hat es sehr lange gedauert, bis sie wieder Fuß gefasst haben. Manche haben so etwas überhaupt nicht weggesteckt", sagt Windeln. Weil Lokführer lange mit ihren Problemen alleine waren, setzten er und einige Kollegen vor zehn Jahren einen psychologischen Dienst durch. Doch auch der kann nicht immer helfen.
Er erinnert sich an einen Kollegen und Freund, der in der gemeinsamen Ausbildung mit Windeln noch Klassenbester gewesen war. Wenig später jedoch hatte er den ersten "Unfall" – vier Wochen Pause,
die Lokführer nennen das krank machen. Keine fünf Tage, nachdem er wieder eine Lok bestiegen hatte, da überfuhr er den nächsten Selbstmörder – ein halbes Jahr Pause, krank gemacht, diesmal mit
therapeutischen Behandlungen. Und wieder ein paar Tage später nach seinem Dienstbeginn der dritte Selbstmörder – der Mann fuhr nie mehr einen Zug. "Als Lokomotivführer war er nicht mehr zu
gebrauchen", erinnert sich Rolf-Dieter Windeln. Für den 68-Jährigen steht allerdings fest: Ein Selbstmord ist in dieser Form die egoistischste Form des Lebens.
 info 24
ÖV - Bahn - Bus - Tram - Schiff
info 24
ÖV - Bahn - Bus - Tram - Schiff